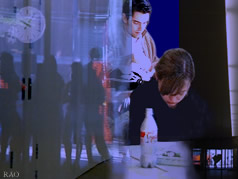|
|
|
|
| Schweizer Jugend |
|
 |
|
|
| Sozialpolitik |
| Sozialhilfe in neun Schweizer Städten - Kennzahlenvergleich 2004 |
Wichtigste Ergebnisse in Kürze: Im
Jahr 2004 stiegen - wie bereits im Vorjahr - die Fallzahlen in den meisten
Städten noch einmal markant an. So wurde in Zürich, Basel und
Winterthur erneut Zuwachsraten von über 10% verzeichnet. Auch Uster
verzeichnete nochmals einen kräftigen Anstieg. |
 |
In Bern, St. Gallen und Luzern sind die Fälle seit Beginn dieses Städtevergleichs 1999 noch nie so stark angestiegen, auch wenn die Zunahmen mit 5-8% im Vergleich zu den erstgenannten Städten eher moderater sind. Entgegen dem Trend verläuft die Entwicklung in Schaffhausen, wo die Fallzahlen mit 1% nur wenig zunahmen, und insbesondere in Frauenfeld, wo sogar eine Fallabnahme von fast 5% verzeichnet wurde.
Im mehrjährigen Vergleich kann festgehalten werden, dass die Fallzahlen in allen Städten in den letzten Jahren gestiegen sind. In den beiden grössten Städten (Basel, Zürich) und im Kanton Zürich allgemein (Zürich, Winterthur, Uster) ist die Fallzunahme in den letzten Jahren jedoch deutlich stärker ausgefallen als in den übrigen Städten und Regionen. Der zaghafte konjunkturelle Aufschwung seit 2003 konnte keine Trendwende herbeiführen.
Die nur wenig verbesserte Wirtschaftslage hat noch kaum auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen, so dass die Arbeitslosigkeit noch wie vor hoch und somit die Arbeitschancen insbesondere auch für die Sozialhilfe-BezügerInnen nach wie vor gering sind. Die massive Verkürzung der Bezugsdauer bei der Arbeitslosenversicherung, die Reduktion der Rahmenfrist und insbesondere die Verlängerung der Beitragszeit für einen neuerlichen Taggeldbezug, die auf Mitte 2003 in Kraft getreten sind, haben in der Sozialhilfe deutliche Spuren hinterlassen.
Die Leute fallen heute rascher in die Sozialhilfe. Eine baldige Entlastung für die Sozialhilfe ist angesichts der stockenden wirtschaftlichen Erholung und der nach wie vor wenig spürbaren Besserung auf dem Arbeitsmarkt nicht in Sicht. Der Fallanstieg hat sich in den meisten Städten denn auch im laufenden Jahr (2005) bisher praktisch unverändert fortgesetzt.
Die steigenden Fallzahlen der letzten Jahre spiegeln sich in zum Teil markant höheren Sozialhilfequoten wider. Die Sozialhilfequote gibt an, wie viele Personen pro 100 Einwohner mit Sozialhilfeleistungen unterstützt werden. Neben der Entwicklung der Fallzahl und der Zusammensetzung der Fälle - mehr Einpersonenhaushalte oder Familien - hat somit auch die Bevölkerungsentwicklung einen Einfluss auf die Sozialhilfequote. In Zürich und Basel liegen die Quoten mit 6.3% bzw. 7.5% sehr hoch. Aber auch in St. Gallen bezogen 2004 5.7% der Bevölkerung eine Sozialhilfeleistung.
In Winterthur ist die Quote nach einer stetigen Zunahme seit 1999 trotz eines relativ starken Bevölkerungswachstums mit 5.2% ebenfalls hoch. Etwas tiefer, aber im Vergleich noch hoch, liegt die Quote mit 4.8% in Bern. Die Sozialhilfequoten in Luzern, Uster und Frauenfeld sind im Vergleich tiefer und haben sich auch in den letzten Jahren nicht markant verändert.
Auch in Schaffhausen hat sich die Quote relativ wenig verändert. Die doch markant unterschiedlichen Niveaus der Sozialhilfequoten zwischen den Städten werden beeinflusst durch die spezifische Bevölkerungsstruktur einer Stadt und dem damit verbundenen unterschiedlichen Armutsrisiko einzelner Gruppen, der regional unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung und den massgebenden lokalen Lebenshaltungskosten (z.B. dem Mietniveau).
Von grossem Interesse ist dabei, welche Haushalts- und Personengruppen besonders häufig auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind und damit ein höheres Sozialhilferisiko aufweisen? Die mit Sozialhilfe unterstützte Personenzahl ist deutlich höher als die eigentliche Fallzahl; die Anzahl Personen pro Fall variiert zwischen den Städten von 1.4 bis 1.9 Personen pro Fall.
| Haushaltsstruktur: 0-90% aller Fälle können den Ein-Personen-Fällen und den Alleinerziehenden zugeordnet werden. Der Anteil der Familien mit Kindern ist zwar nicht sehr hoch - er hat jedoch in den grösseren Städten deutlich zugenommen. |
|
| Altersgruppen: Die Sozialhilfequote ist nicht für jede Altersgruppe gleich hoch. Sie ist bei den Kindern und Jugendlichen in allen Städten mit Abstand am höchsten; sie ist rund doppelt so hoch wie die Sozialhilfequote insgesamt. Am Eindrücklichsten ist die Quote in Basel: Jedes siebte Kind ist in Basel im Laufe eines Jahres zusammen mit seiner Familie auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. Hoch liegt die Quote auch bei den 18-25-jährigen Personen, insbesondere in den grossen Städten Basel und Zürich. |
|
| Nationalität: Etwas mehr als die Hälfte der SozialhilfebezügerInnen hat das Schweizer Bürgerrecht. Welches sind nun die Hauptgründe, dass es Menschen ermöglicht, wieder von der Sozialhilfe wegzukommen? Die beiden wichtigsten Gründe sind nach wie vor die Erwerbsaufnahme oder die Ausrichtung von der Sozialhilfe vorgelagerten Sozialversicherungsleistungen. Bei den Sozialversicherungsleistungen stehen v.a. die Arbeitslosenversicherung sowie der Bezug von IV- oder AHV-Renten im Vordergrund. Diese beiden Gründe werden bei rund 50% bis 70% der Abgänge angegeben. Die Sozialhilfe nimmt also für einen erheblichen Teil der Fälle eine überbrückungsfunktion wahr. Ein weiterer, gewichtiger Grund ist der Wegzug eines Sozialhilfefalles. Inwieweit dies tatsächlich mit einer Ablösung von der Sozialhilfe verbunden ist oder ob der Fall danach lediglich in einer anderen Gemeinde Sozialhilfe bezieht, kann in diesem Vergleich nicht geklärt werden. |
|
|
|
Die detaillierte Finanzuntersuchung in allen Städten im letzten Jahr hat ergeben, dass grundsätzlich lediglich die Netto-Kosten zwischen den Städten mit Einschränkungen vergleichbar sind. Die unterschiedliche Buchhaltungsvorschriften und Buchungspraxis in den Städten lassen nach wie vor einen beträchtlichen Interpretationsspielraum bezüglich der Ergebnisse offen.
Insbesondere die absolute Höhe der Kosten pro Fall und Personen werden neben unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen Städten (z.B. für Mieten) und der Zusammensetzung der Fälle (Anteile kinderreiche Familien, Ein-Personen-Fälle, Kurzzeitbezüger, usw.). auch von weiteren Faktoren beeinflusst:
Je
nach dem, wie stark eine Stadt ihre Einrichtungen wie z.B. Heime mehr objekt-
oder subjektfinanziert1, schwanken die Kosten bei einer angeordneten Massnahme
erheblich. Daher wird im diesjährigen Vergleich auf eine detaillierte
Darstellung der Kosten in den einzelnen Städten verzichtet. Vor dem
nächsten Städtevergleich werden zusätzliche Abklärungen
erfolgen, die diesen Aspekten vermehrt Rechnung tragen sollen.
Dennoch
lassen sich ein paar Aussagen zu den Kosten insgesamt machen: In allen
Städten haben sich die Netto-Kosten 2004 erhöht.Die
Zunahme der Nettokosten hat verschiedene Ursachen:
Zum einen ist deutlich spürbar, dass die Invalidenversicherung (IV) in den letzten Jahren weniger (rasch) Rentenentscheide fällt als früher. Im weiteren sind die Auswirkungen der Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosentaggelder, der Reduktion der Rahmenfrist und die Verlängerung der Beitragsdauer für einen neuerlichen Taggeldbezug, die auf den 1.7.2003 in Kraft getreten sind, ebenfalls nachhaltig spürbar in der Sozialhilfe.
Die Netto-Kosten pro Fall betragen 2004 im Jahresdurchschnitt rund Fr. 14 000 und liegen somit rund 10% über dem Vorjahreswert.
Bei der Entwicklung der Nettokosten pro Fall im Durchschnitt aller, jeweils am Vergleich teilgenommenen Städte gilt:
Der Anstieg der Kosten seit zwei Jahren ist deutlich sichtbar, auch wenn das Niveau von 1999 noch nicht ganz wieder erreicht wurde. Die Entwicklung der Kosten pro Fall kann in den einzelnen Städten natürlich im Detail anders verlaufen. So waren z.B. die Nettoausgaben pro Fall in Schaffhausen 2004 gegenüber 2003 rückläufig. In allen anderen Städten sind sie Ausgaben pro Fall gestiegen - am stärksten in Basel, St. Gallen, Luzern und Uster. (Etwas) moderater waren die Steigerungen in Bern, Winterthur und Zürich.
 |
|
Die Sozialhilfequote der 18-25-jährigen Personen - in der Diskussion allgemein als junge Erwachsene bezeichnet - liegt im Vergleich zu den anderen Altersgruppen hoch
In Basel bezogen gut 11% aller Personen in der Stadt zwischen 18 und 25 Jahren im Jahr 2004 mindestens einmal eine Sozialhilfeleistung. In St. Gallen betrug dieser Anteil 7.5%, in Bern gut 5% und in Uster knapp 4%. Nicht in allen Städten ist die Quote dieser Gruppe jedoch - neben den Kindern unter 18 Jahren - die höchste. In Bern liegt z.B.die Quote der 36-bis 50-Jährigen sogar noch etwas höher. Dennoch bedarf die besondere Situation der jungen Erwachsenen in allen Städten einer speziellen Beobachtung und erfordert spezifische Massnahmen.
Der Anteil der nur sporadisch unterstützten Personen ist bei den jungen Erwachsenen recht gross. Viele Personen der Altersgruppe der 18-25-Jährigen in der Sozialhilfe gehört zu den zunehmend unfreiwilligen "Jobbern" mit Einkommenslücken zwischen den Beschäftigungen, die sie mit Sozialhilfe überbrücken.
Arbeitsmarkt- und sozialpolitisch ist es zentral, dass es der Gesellschaft gelingt, diesen jungen Menschen eine Perspektive zu eröffnen. Gelingt dies nicht und die jungen Erwachsenen schaffen den Einstieg ins Berufsleben nicht oder nur temporär, hat das oft dauernde Auswirkungen auf ihre Berufskarrieren. Die positiven Erfahrungen in der Arbeitswelt der SchulabgängerInnen sind Voraussetzung für ein "learning by doing" im Arbeitsprozess. Diese Erfahrungen und die damit verbundene soziale Anerkennung führen zu den notwendigen Erfolgserlebnissen, die die Eigenständigkeit und Flexibilität der jungen Menschen beim Erwachsenwerden stärken und so den Boden bereiten für eine erfolgreiche und nachhaltige Integration in den Arbeitsprozess und die Gesellschaft.
Sowohl die
nachhaltige primäre Arbeitsintegration, die Gestaltung des Schulaustritts
in die Berufswelt (Ausbildung, Lehrstellen, Praktikumsstellen, nachhaltige
Begleitung des Schulübergangs in die Arbeitswelt usw.) wie auch die
Lösung der Schuldenproblematik bei vielen jungen Erwachsenen sind
aber nicht die primären Aufgaben der Sozialhilfe: Es sind alle
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kräfte gefragt,
diese Probleme an der Wurzel zu bekämpfen.
|
In der Sozialhilfe - dem letzten Netz der sozialen Sicherheit - werden die verpassten Chancen dann jedoch sichtbar und führen zur politischen Diskussion, insbesondere wenn ihr Anteil in der Sozialhilfe zunehmend wächst. Oft haben aber die Heranwachsenden dann bereits eine lange Reihe von schlechten Erfahrungen gemacht; sie sind mut- und hoffnungslos und häufig bereits schwer zu bewegen, etwas zu verändern. Die besagten Desintegrationsprozesse sind bereits in vollem Gange und die überschuldung oft schon da. Die Desintegration eines erheblichen Teils der jungen Generation kommt die Gesellschaft aber auf die Dauer ausserordentlich teuer zu stehen. Die Sozialhilfequote der jungen Erwachsenen ist nicht nur hoch, sondern in den letzten Jahren in vielen Städten recht deutlich gestiegen - so vor allem in Zürich, Basel, Winterthur, St. Gallen und Frauenfeld.
Die
städtische Sozialhilfe ist in der Folge nicht untätig geblieben:
Es sind verschiedene Projekte gestartet und Massnahmen ergriffen worden. Ziel all dieser Bemühungen soll es sein, die Sozialhilfe für diese Altersgruppe nicht "attraktiv" zu gestalten, dann aber umgekehrt intensive Beratungs- und Integrationsangebote bereit zu stellen, wenn die jungen Menschen dann trotzdem in der Sozialhilfe anlaufen. Der Beratungsaufwand ist für diese Altersgruppe ungleich grösser (Bern rechnet z.B. bei ihrem niederschwelligen Integrationsprojekt NIP mit einer doppelt so hohen Beratungszeit wie im Durchschnitt).
Der
vorliegende Vergleich zeigt aber auch, dass das Problem nicht in allen
Städten gleich akut ist:
Die Grösse der Stadt bzw. ihr grossstädtische Umfeld sowie ihre Zentrumsfunktion für das umliegende Gebiet haben einen wesentlichen Einfluss. Dennoch ist es in allen Städten eine zentrale Aufgabe, gerade den jungen Menschen eine nachhaltige (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wichtig ist hier der Aspekt, dass es eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt sein soll und die Arbeitsintegrationsprojekte mit Hilfe von Beschäftigungsprogrammen bzw. ergänzenden oder zweiten Arbeitsmärkten für dieses KlientInnensegment aller höchstens als kurzfristige Massnahme in Frage kommt. Im Vordergrund steht eine langfristige und tragfähige Lösung für die jungen Erwachsenen und nicht eine möglichst rasche Ablösung in einen Temporärjob - dabei besteht die Gefahr, dass die Menschen schon kurze Zeit später wieder bei der Sozialhilfe anklopfen und sich ihre Situation nicht nachhaltig verbessert hat.
Aus Untersuchungen mit Daten aus der Sozialhilfe Basel sowie aus den Angaben der Städte sind überproportional häufig junge (schwangere) Schweizer Frauen und eher junge Erwachsene mit ausländischer Nationalität betroffen. Wenn die jungen Erwachsenen über eine Ausbildung verfügen und auch bereits im Arbeitsprozess standen, arbeiteten sie vor dem Sozialhilfeeintritt meistens nicht mehr in ihrem gelernten Beruf. In den meisten Städten haben die jungen Erwachsenen bereits gearbeitet, wenn sie in die Sozialhilfe kommen. Die wenigsten kommen direkt von der Schule/Ausbildung zur Sozialhilfe. Die Sozialhilfe nimmt eine eigentliche Drehtürfunktion wahr: Job - Arbeitsverlust - Sozialhilfe - Job ...
Wenn die Erwerbstätigkeit nicht mindestens ein Jahr gedauert hat oder die Personen noch nicht zehn Jahre in der Schweiz wohnhaft sind, kann kein Arbeitslosentaggeld bezogen werden und die Arbeitslosen kommen sehr rasch zur Sozialhilfe. Einige Städte kennen eigentliche Arbeitsintegrationsprogramme für junge Erwachsene. Alle Städte setzten die finanzielle Unterstützung bewusst möglichst tief an, um keinerlei Anreize zu einem Sozialhilfebezug statt einem Arbeitsantritt zu setzen.
In allen Städten wird bei den jungen Erwachsenen vorausgesetzt, dass sie nicht alleine wohnen (bei den Eltern oder Wohngemeinschaft) - es wird ihnen nur ein Wohnanteil bezahlt, nicht jedoch die ganze Miete einer Wohnung. Die Lebenshaltungskosten werden ebenfalls tiefer angesetzt - wer sich umgekehrt aktiv um eine Verbesserung der Situation bemüht, bekommt eine finanzielle Motivationszulage. Ganz zentral ist daher die Beratungs- und Begleitungsfunktion der Sozialhilfe für diesen Teil der jungen Menschen, um sie aus ihrer Resignation wieder heraus zu führen und ihnen die Möglichkeit zu erschliessen, realistische Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.
Die eingeleitenden Massnahmen speziell für die jungen Erwachsenen können angesichts der komplexen Problemlagen kurzfristig nicht eine markante Trendwende einleiten - die Massnahmen und dabei insbesondere die intensive Beratung sind als Investition zu betrachten und werden mittel- bis längerfristig die erwünschte Wirkung zeigen. Die Wirkung wird umso eher eintreten, je früher die Probleme vieler Jugendlichen beim übergang zwischen Schule und Erwerbstätigkeit reduziert und diese Prozesse intensiv begleitet werden. Die Massnahmen der Städte im Sozialhilfebereich sind in Ergänzung zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) zu sehen und werden zudem ständig an den notwenigen Bedarf angepasst.
Insgesamt
muss festgehalten werden:
Alle Städte haben nach wie vor ein enormes Fallaufkommen zu bewältigen. Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz, das in den vergangenen Jahren zunehmend auch strukturelle Risiken abdecken muss, da im Sozialversicherungsnetz Lücken klaffen. Wenn aufgrund von strukturellen und konjunkturellen Entwicklungen in der Wirtschaft immer mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen und die bestehenden Sozialversicherungen zunehmend restriktiver reglementiert werden, führt dies zu einem sprunghaften Anstieg bei den Sozialhilfefällen. Um die Sozialhilfe auch langfristig finanzieren zu können, müssen wir einerseits die strukturellen Risiken besser durch das Sozialversicherungsnetz abdecken und anderseits genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen, damit die Menschen eng beraten und begleitet werden können und somit rasch und nachhaltig von der Sozialhilfe wieder abgelöst werden können.
| Quelle: Text Städteinitiative, 1. Juli 2005 |
| Sozialpolitik Lösungsansätze |
| Links |
| Externe Links |
|
 |
|
|