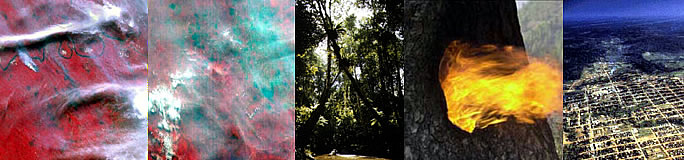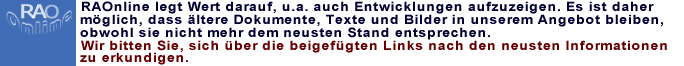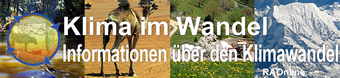|
Berichte
über den Klimawandel - Globale Berichte
|
|
IPCC-Bericht zum globalen Klimawandel
|
 |
 |
IPCC-Bericht zum globalen Klimawandel |
 |
Klimawandel Weitere Informationen |
|
|
IPCC
Report 2022: Sachstandsbericht Klimawandel |
 |
| Sechster IPCC-Sachstandsbericht AR6-WGII |
 |
| Hauptaussagen des IPCC‐Sonderberichts Naturwissenschaftliche Grundlagen |
| Sechster IPCC-Sachstandsbericht (AR6) - Beitrag von Arbeitsgruppe I: |
| Hauptaussagen aus der Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung (SPM) |
| Version 2 vom 9. August 2021 |
| der Deutschen IPCC‐Koordinierungsstelle |
 |
Die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (Summary for Policymakers SPM) ist in vier Teile gegliedert:
| A |
Der aktuelle Zustand des Klimas |
| B |
Anpassungsmassnahmen und förderliche Bedingungen |
| C |
Klimainformationen für Risikobewertung und regionale Anpassung |
| D |
Begrenzung zukünftigen Klimawandels |
|
 |
A. Der aktuelle Zustand des Klimas |
A 1. Es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Es haben weitverbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, dem Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre stattgefunden.
A 2. Das Ausmass der jüngsten Veränderungen im gesamten Klimasystem und der gegenwärtige Zustand vieler Aspekte des Klimasystems sind seit vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden beispiellos.
A 3. Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Seit dem Fünften Sachstandsbericht (AR5) gibt es stärkere Belege für beobachtete Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen sowie insbesondere für deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen.
A 4. Auf Basis von verbesserten Kenntnissen über Klimaprozesse, Nachweise aus der Erdgeschichte und die Reaktionen des Klimasystems auf zunehmenden Strahlungsantrieb lässt sich die Gleichgewichtsklimasensitivität am besten mit 3 °C beziffern, wobei die Bandbreite im Vergleich zum AR5 eingegrenzt wurde.
 |
B. Mögliche Klimazukünfte |
B 1. Die globale Oberflächentemperatur wird bei allen betrachteten Emissionsszenarien bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen. Eine globale Erwärmung von 1,5 °C und 2 °C wird im Laufe des 21. Jahrhunderts überschritten werden, es sei denn, es erfolgen in den kommenden Jahrzehnten drastische Reduktionen der CO2- und anderer Treibhausgasemissionen.
B 2. Viele Veränderungen im Klimasystem werden in unmittelbarem Zusammenhang mit der zunehmenden globalen Erwärmung grösser. Dazu gehören die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen, marinen Hitzewellen und Starkniederschlägen, landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in einigen Regionen, der Anteil heftiger tropischer Wirbelstürme sowie Rückgänge des arktischen Meereises, von Schneebedeckung und Permafrost.
B 3. Fortschreitende globale Erwärmung wird laut Projektionen den globalen Wasserkreis-lauf weiter intensivieren, einschliesslich seiner Variabilität, sowie der globalen Monsunniederschläge und der Heftigkeit von Niederschlags- und Trockenheitsereignissen.
B 4. Die Kohlenstoffsenken in Ozean und Landsystemen werden bei Szenarien mit steigenden CO2-Emissionen laut Projektionen die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre weniger wirksam verlangsamen.
B 5. Die Kohlenstoffsenken in Ozean und Landsystemen werden bei Szenarien mit steigen-den CO2-Emissionen laut Projektionen die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre weniger wirksam verlangsamen.
 |
C. Klimainformationen für Risikobewertung und regionale Anpassung |
C 1. Natürliche Antriebsfaktoren und interne Schwankungen werden die vom Menschen verursachten Veränderungen modulieren, vor allem auf regionaler Ebene und in naher Zukunft; über Jahrhunderte betrachtet hat dies geringe Auswirkungen auf die globale Erwärmung. Es ist wichtig, diese Modulationen bei der Planung für die gesamte Bandbreite möglicher Veränderungen zu berücksichtigen.
C 2. Bei weiterer globaler Erwärmung wird es laut Projektionen in jeder Region in zunehmendem Masse zu gleichzeitigen und vielfältigen Veränderungen von klimatischen Antriebsfaktoren mit Relevanz für Klimafolgen (climatic impact-drivers, CIDs)* kommen. Veränderungen von mehreren CIDs wären bei 2 °C im Vergleich zu 1,5 °C globaler Erwärmung weiterverbreitet und bei höheren Erwärmungsniveaus sogar noch weiter verbreitet und/oder ausgeprägter.
C 3. Klimawandelbedingte Änderungen, die mit geringer Wahrscheinlichkeit auftreten - wie der Zusammenbruch von Eisschilden, abrupte Veränderungen der Ozeanzirkulation, einige zusammengesetzte Extremereignisse und eine Erwärmung, die wesentlich über die als sehr wahrscheinlich† bewertete Bandbreite der künftigen Erwärmung hinausgeht - können nicht ausgeschlossen werden und sind Teil der Risikobewertung.
| * |
Klimatische Antriebsfaktoren mit Relevanz für Klimafolgen (climatic impact-drivers, CIDs) sind Zustände des physikalischen Klimasystems (z. B. Mittelwerte, Ereignisse, Extreme), die sich auf Bereiche von Gesellschaft o-der von Ökosystemen auswirken. Je nach Systemtoleranz können CIDs und ihre Veränderungen schädlich, vor-teilhaft oder neutral sein oder eine Mischung aus beidem für alle interagierenden Systembereiche und Regionen darstellen. CID-Typen sind zum Beispiel Hitze und Kälte, Nässe und Trockenheit, Wind, Schnee und Eis, küstennaher und offener Ozean. |
| † |
Jede Aussage beruht auf einer Bewertung der zugrundeliegenden Belege und deren Übereinstimmung. Ein Vertrauensniveau wird unter der Verwendung von fünf Abstufungen angegeben: sehr gering, gering, mittel, hoch und sehr hoch, und kursiv gesetzt, zum Beispiel mittleres Vertrauen. Folgende Begriffe wurden verwendet, um die bewertete Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses anzugeben: praktisch sicher 99–100 % Wahrscheinlichkeit, sehr wahrscheinlich 90–100 %, wahrscheinlich 66–100 %, etwa ebenso wahrscheinlich wie nicht 33–66 %, unwahrscheinlich 0–33 %, sehr unwahrscheinlich 0–10 %, besonders unwahrscheinlich 0–1 %. Zusätzliche Begriffe (äusserst wahrscheinlich 95–100 %, eher wahrscheinlich als nicht <50–100 %, und äusserst unwahrscheinlich 0–5 %) können ebenfalls verwendet werden, wo angebracht. Bewertete Wahrscheinlichkeiten wer-den kursiv gesetzt, zum Beispiel sehr wahrscheinlich. Gleiches galt für den AR5. In diesem Bericht werden, sofern nicht anders angegeben, eckige Klammern [x bis y] gesetzt, um die bewertete sehr wahrscheinliche Bandbreite bzw. das 90%-Intervall anzugeben. |
 |
 |
D. Begrenzung zukünftigen Klimawandels |
D 1. Aus naturwissenschaftlicher Sicht erfordert die Begrenzung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung auf ein bestimmtes Niveau eine Begrenzung der kumulativen CO2-Emissionen, wobei zumindest netto Null CO2-Emissionen erreicht werden müssen, zusammen mit starken Verringerungen anderer Treibhausgasemissionen. Eine starke, rasche und anhaltende Verringerung von CH4-Emissionen würde auch den Erwärmungseffekt begrenzen, der sich aus abnehmender Luftverschmutzung durch Aerosole ergibt, und die Luftqualität verbessern
D 2. Szenarien mit niedrigen oder sehr niedrigen Treibhausgasemissionen (SSP1-1.9 und SSP1-2.6)(Shared Socioeconomic Pathway SSP) führen im Vergleich zu Szenarien mit hohen und sehr hohen Treibhausgasemissionen (SSP3-7.0 oder SSP5-8.5) innerhalb von Jahren zu erkennbaren Auswirkungen auf die Treibhausgas- und Aerosolkonzentrationen und die Luftqualität. Bei einem Vergleich dieser gegensätzlichen Szenarien beginnen sich erkennbare Unterschiede zwischen den Trends der globalen Oberflächentemperatur innerhalb von etwa 20 Jahren von der natürlichen Variabilität abzuheben, bei vielen anderen klimatischen Einflussfaktoren erst über längere Zeiträume hinweg (hohes Vertrauen).
Bitte beachten
Die vorliegende Übersetzung der Hauptaussagen aus dem Beitrag von Arbeitsgruppe I zum Sechsten IPCC-Sachstandsbericht beruht auf der englischen Onlineversion vom 9. August 2021. Sie wurde in enger Absprache mit Fachleuten mit dem Ziel erstellt, die im Originaltext verwendete Sprache möglichst angemessen wiederzugeben.
Übersetzt wurden hier die Hauptaussagen (also der jeweils fett hervorgehobene Absatz am Anfang eines jeden Abschnitts) der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (Summary for Policymakers, SPM) ohne Abbildungen. Die gesamte SPM beruht auf einem sehr viel ausführlicheren Bericht und enthält Verweise auf dessen zugrundeliegende Kapitel, die aber zwecks besserer Lesbarkeit hier nicht enthalten sind.
Auf der Grundlage des wissenschaftlichen Verständnisses können die wichtigsten Erkenntnisse als Tatsachenaus-sagen formuliert oder mit einem bewerteten Vertrauensniveau verbunden werden, das in der IPCC-Sprachregelung angegeben wird.
 |
| Quelle:
Text Koordinationsstelle IPCC, 9. August 2021 |
|
| Sechster IPCC-Sachstandsbericht AR6-WG1 |
 |
 |
 |
| Hauptaussagen des IPCC‐Sonderberichts Naturwissenschaftliche Grundlagen |
 |
 |
 |
| Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (Summary for Policymakers SPM) |
 |
 |
 |
| deutsche Übersetzung |
 |
|
|
Zahlreiche Bereiche werden vom weltweiten Temperaturanstieg betroffen sein, dazu gehören u.a. :
nach
oben
| Sechster IPCC-Sachstandsbericht AG6 |
 |
 |
| Quelle: IPCC |
| Sechster IPCC-Sachstandsbericht (AR6-WGI) |
Naturwissenschaftliche Grundlagen
|
| Beitrag von Arbeitsgruppe I zum Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) |
| 2021, deutsch, 45 Seiten |
| 3 MB |
 |
|
 |
nach
oben
|
Weitere Informationen
|
 |
| RAOnline: Weitere Informationen über Länder |
|
Links
|
 |
 |
 |
Externe Links |
|